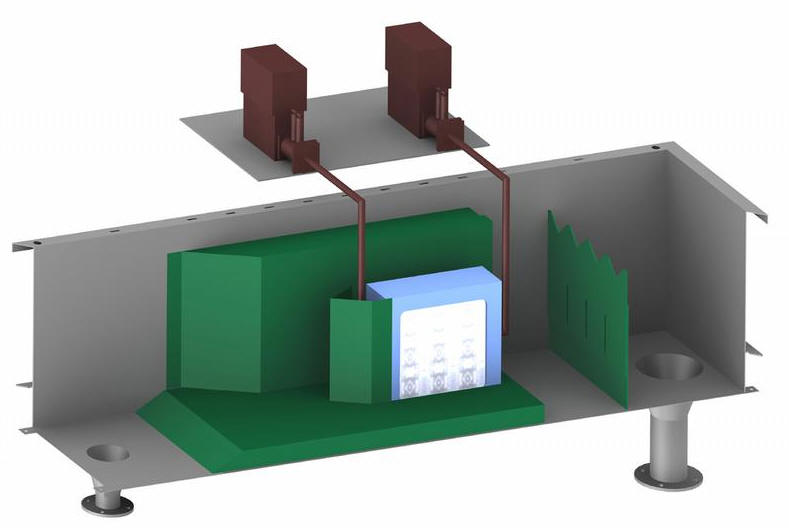|
|
 April
2005 April
2005
Wasser-/Abwassernachrichten
|
Globale Zerstörung der fließenden
Binnengewässer dramatisch
29.04.2005 Umwelt Dialog
Von den großen Strömen der Erde sind mehr als die Hälfte in Dämme
gezwungen und fließt nicht mehr. Ein Forscherteam der schwedischen
Universität von Umea hat die großen Flüsse genau untersucht und ist zum
Schluss gekommen, dass die Folgen des Dammbaus massive Auswirkungen auf
die Umwelt haben, denn Fließgeschwindigkeit und Bodenerosion hängen damit
zusammen, berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature.
Umea/Boulder (pte) - Das Team um Christer Nilsson hat die 292 großen
Flusssysteme der Welt untersucht. 172 dieser Flüsse sind durch Dämme
beeinträchtigt, in Europa sind es sogar mehr als 60 Prozent. Einzige
Ausnahmen bildet die vergleichsweise dünn besiedelte Region Australiens,
Neuseelands und der pazifischen Inselwelt. Dort sind nur 17 Prozent der
Flusslandschaften durch Dämme verändert. Die Veränderungen für die
umliegenden Regionen und für die Flüsse selbst beschreibt auch der
Wissenschaftler James Syvitski von der University of Colorado in Boulder.
Die Dämme verhindern nämlich, dass abgelagerte Sedimente von den Flüssen
ins Meer transportiert werden. In den Mündungen der Flüsse entstehen
dadurch häufig schwere Schäden durch Erosion. Ein Beispiel hierfür ist das
Mississippi-Delta.
Nach Nilssons Angaben sind insbesondere für Südasien und Südamerika
gewaltige Staudämmprojekte vorgesehen. Alleine am Yangtse-Fluss in China
sind neben dem umstrittenen Drei-Schluchten-Projekt (Bild) 49 weitere
Dämme geplant. "Wenn Menschen das globale Bild der zerstörten
Flusslandschaften sehen, agieren sie anders", so der Experte. Echte
natürliche Flussläufe werden immer seltener. Die Wissenschaftler hoffen,
dass insbesondere bei den geplanten aber heftig umstrittenen Großprojekten
ein Umdenken einsetzt. Auch der britische Wissenschaftler Mike Dunbar vom
Centre for Ecology and Hydrology in Wallingford hofft, dass die
Forschungsergebnisse wie ein Weckruf wirken.
Tests zeigen alarmierend viel Nitrat im
Trinkwasser
Oberösterreichische Nachrichten 29.4.2005
LINZ. Von 1183 Wasserproben einer aktuellen Testreihe lagen 72 über dem
Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter: Oberösterreichs Hausbrunnen
sind trotz teurer Sanierungs-Programme stark belastet.
Rund 100.000 Haushalte im Land beziehen ihr Trinkwasser noch immer
nicht von Versorgungsanlagen, sondern aus dem eigenen Brunnen. Vor allem
im Raum Machland, Eferdinger Becken und Unteres Ennstal zeigte eine
Messreihe des Arbeiterkammer-Konsumentenschutzes hohe Belastungen. Nitrate
gelten als Krebs erregend, Abbauprodukte hemmen den Sauerstofftransport im
Blut. ... [weiter]
Täglich versickern Milliarden Liter Trinkwasser
Franz.Alt Sonnenseite, 28.04.2005 - Jeden Tag versickert in
Deutschland so viel Trinkwasser durch defekte Rohre in das Erdreich wie
mehr als elf Millionen Bundesbürger täglich verbrauchen. Darauf weist der
Rohrleitungsbauverband (rbv) anlässlich seiner Jahrestagung in Magdeburg
hin.
Die 1,138 Milliarden Liter pro Tag entsprechen nach Berechnungen des
Statistischen Bundesamts rund acht Prozent des gesamten Wasseraufkommens.
Würde diese Wassermenge in Tetra-Paks à ein Liter abgefüllt, reichten die
hochkant gestellten Behälter 3,4 mal um den Äquator.
Der Rohrleitungsbauverband (rbv) vertritt seit über fünfzig Jahren die
Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und auf europäischer Ebene.
Seine mehr als 500 Mitglieder beschäftigen insgesamt rund 40.000
Arbeitnehmer. Der rbv ist Mitglied in der Bundesvereinigung der Firmen im
Gas- und Wasserfach (figawa), der Interessenvertretung der Dienstleister
und Hersteller der Versorgungswirtschaft in der Gas- und Wasserbranche.
Trinkwasser-Kühlgeräte stellen oft ein
gesundheitliches Risiko dar – 'Saarländisches Trinkwasser aus der Leitung
hat gute Qualität'
Pressemitteilung 27.04.2005 Ministerium für Umwelt des Saarlandes
27.04.2005 - Schenkt man den Wettervorhersagen der Meteorologen
Glauben, so dürfen wir uns am kommenden Wochenende auf sommerlich warme
Temperaturen freuen.
Wer nach getaner Gartenarbeit oder einem schönen Spaziergang in der
freien Natur seinen Durst mit einem kühlen Glas Wasser löschen möchte,
sollte aber zu einem Glas Mineralwasser aus der Flasche oder zu einem Glas
Leitungswasser greifen.
Wie das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des
Universitätsklinikums Freiburg festgestellt hat, sind viele der
handelsüblichen Wasserkühlgeräte nämlich nicht nur umweltschädlich,
sondern stellen häufig auch eine nicht zu unterschätzende Infektionsgefahr
für den Verbraucher dar. Im Rahmen einer Untersuchung, die das Institut
der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt hat, kam es bei 20 von 26
untersuchten Wasser-Kühlgeräten zu erheblichen Verunreinigungen des
Trinkwassers mit Keimzellen. Drei der 26 untersuchten Geräte zeigten - so
die Studie des Instituts - sogar grobe Verschmutzungen auf.
Zu den Keimzellen, die in dem verunreinigten Wasser gefunden wurden,
gehörte auch ein besonders gefährlicher Keim, pseudomonas aeruginosa, der
vor allem bei abwehrgeschwächten Patienten lebensbedrohliche Infektionen
verursachen kann. In manchen Geräten wurden sogar coliforme Keime
nachgewiesen, die auf fäkale Verunreinigungen des Trinkwassers durch
Menschen und Tiere hinweisen. 'Die Ergebnisse, die das Institut für
Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Freiburg im
Rahmen seiner Studie ermittelt hat, und die Infektionsgefahr, die für den
Verbraucher von diesen Geräten ausgehen kann, sind wirklich alamierend.
Auch die Umweltbelastung, die durch die so genannten Watercool-Syteme
entsteht, ist nicht unerheblich', so Umweltminister Stefan Mörsdorf.
Das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene Freiburg hat im
Rahmen seiner Untersuchungen errechnet, dass durch den Gebrauch von
Trinkwasserkühlsystemen Tausende von Tonnen Schadstoffemissionen
entstehen, wenn bei dieser Art der Wasserversorgung Millionen von Liter
Wasser und Leergut kreuz und quer über die Straßen transportiert werden.
Der Transport von einem Liter Wasser über eine Strecke von 500 Kilometer
erzeugt dabei rund 210 Gramm Kohlendioxid.
Da kaum eines der getesteten Geräte die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung und der Mineral- und Tafelwasserverordnung erfüllten
konnte, und auch aufgrund der Umweltbelastung durch Emissionsschadstoffe,
die durch den Transport des Wassers und den Betrieb der Geräte verursacht
werden, rät das Umweltministerium den Bürgerinnen und Bürgern, auf den
Gebrauch von Trinkwasserkühlgeräten zu verzichten.
'Die Qualität unseres saarländischen Trinkwassers ist so hervorragend,
dass wir auf teure Trinkwassergeräte verzichten und getrost unser Wasser
direkt aus der Leitung trinken können. Denn einen weiteren Vorteil hat das
Leitungswasser außerdem. Es ist nicht nur qualitativ unbedenklich und
kostengünstig, es kommt darüber hinaus auch direkt zu uns ins Haus und
muss nicht erst noch für teures Geld in großen Gebinden gekauft und nach
Hause gekarrt werden', so Umweltminister Stefan Mörsdorf.
Amur leidet unter Abwasser
MDZ 27-04-2005 - Moskauer Deutsche Zeitung-Infodienst
Die Wasserqualität des Amur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich
verschlechtert. Entsprechend lässt die Qualität des Trinkwassers zu
wünschen übrig, auch habe der Fischbestand abgenommen, wie Umweltexperten
nun herausgefunden haben. Die Hauptschuld liege bei chinesischen Bauern
und Viehzüchtern, die ihre Abwasser in den Grenzfluß zwischen Russland und
China leiten. Die Argumentation der Experten: Auf chinesischer Seite leben
76 Milllionen Einwohner, auf russischer hingegen nur 900 000 Menschen –
somit sei die Wahrscheinlichkeit, dass die chinesische Seite den Fluss
stärker verschmutze, rein rechnerisch um das 84-fache höher. Das sagte der
Direktor der Umweltvereinigung „Amur-Soes“, Petr Osipow. Die Biosphäre des
Flusses könne vor allem durch die Anpflanzung von Bäumen entlang des Ufers
wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, so ein Lösungsvorschlag.
Pressemitteilung Hochschule Niederrhein - Niederrhein University of
Applied Sciences, 27.04.2005 10:28
Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein untersucht
industriellen Einsatz der Membrantechnik in der Textilveredlungsindustrie
Hinter dem abstrakten Titel "Aufbereitung, Recycling und
Wiederverwertung von Abwasser, Restflotten und Konzentraten der
Membrantechnik aus der Textilveredlungsindustrie" versteckt sich ein
Forschungsvorhaben, dessen Ergebnisse in ökologischer und ökonomischer
Hinsicht für die betroffenen Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen
versprechen. Chemiker und Veredlungstechniker des Fachbereichs Textil- und
Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, die
Moerser Ingenieurgesellschaft MDS Prozesstechnik und der Krefelder
Textilveredler Voss, Biermann, Labaczek (VBL) werden bei ihren
Forschungsarbeiten vom NRW-Umweltministerium mit 517.000 Euro gefördert.
Dabei besteht das Ziel darin, die beim Veredlungsprozess - dem Färben
und Beschichten von Textilien - entstehenden Abwässer soweit zu reinigen,
dass sie als Frischwasser erneut verwendet werden können. Laborversuche
haben gezeigt, dass das grundsätzlich möglich ist. Ob und wie es mit
unterschiedlichen Farbstoffen, textilen Materialien und
Veredlungstechnologien in der industriellen Praxis funktioniert, sollen
die Forschungsarbeiten zeigen. Dabei werden mit der Ultrafiltration und
der Umkehrosmose zwei Membrantechniken eingesetzt, die sich in ihrer
Wirkung ergänzen, erläutern Prof. Dr. Marie-Louise Klotz und Prof. Dr.
Ulrich Eicken vom Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik und Dr.
Dieter Böttger, Geschäftsführer der Firma MDS. Bei der Ultrafiltration
durchlaufen die Abwässer nach dem "Veredlungsbad" einen Filter, in dem die
Farbstoffpartikel abgetrennt werden. Die gelösten Inhaltsstoffe wie
Farbstoffe, Tenside und Salze werden dann mit der Umkehrosmose eliminiert,
ein Verfahren, das wie die Meerwasserentsalzung funktioniert. Das
herausgefilterte Konzentrat, zum Beispiel Farbstoffreste, wird biologisch
und chemisch auf seine weitere Verwendungsmöglichkeit untersucht. So sei
auch zu prüfen, sagt Professorin Dr. Klotz, ob es wiederum zur Färbung
oder auch für ganz andere Zwecke eingesetzt werden könne.
Die Reduzierung der Abwassermenge ist in der Textilveredlungsindustrie
eine vordringliche Aufgabe. Die sehr strengen deutschen Gesetze und die
nicht unerheblichen Abwasserabgaben - aus ihnen wird übrigens auch das
Forschungsprojekt finanziert - zwingen die Unternehmen, ihren
Wasserverbrauch weiter zu senken. Zwischen 80 und 90 Prozent Einsparung,
schätzt Dr. Dieter Böttger, ließen sich aufgrund der Forschungsarbeiten,
deren Umsetzbarkeit jeweils direkt beim industriellen Partner in Krefeld
überprüft wird, erzielen. Dabei sei die Verringerung der "Schmutzfracht"
grundsätzlich als wichtiger einzustufen als die der Wassermenge, so Prof.
Dr. Ulrich Eicken: "Das Wasser muss brauchbar sein". Erste Anfragen aus
dem Ausland nach Prüfergebnissen liegen bereits vor.
Neuer Ansatz für Reinigung verseuchten
Grundwassers
Pressemitteilung Universität Leipzig, 22.04.2005 14:19
Die Universität Leipzig präsentiert auf der Internationalen Fachmesse
für Wasser-Abwasser-Abfall-Recycling (IFAT) in München, 25. - 29. April
2005, der Leitmesse für Umwelt und Entsorgung, neueste
Forschungsergebnisse für die Reinigung von Wässern aus dem Institut für
Analytische Chemie der Fakultät für Chemie und Mineralogie. Die
Kontamination der Böden an Standorten ehemaliger Munitionsfabriken sowie
in militärisch genutzten Anlagen durch Sprengstoffe und Abbauprodukte
(sprengstofftypische Verbindungen - STV) führt zu Beeinträchtigungen der
Qualität des Grundwassers. Dies wird in Elsnig, Kreis Torgau-Oschatz, auf
dem Gelände der ehemaligen WASAG (Westfälisch-Anhaltinische-Sprengstoff-Aktiengesellschaft)
näher untersucht.
Ein neuer Ansatz zur Aufbereitung von STV-kontaminierten Wässern wird
im Rahmen eines Verbundvorhabens durch ein zweistufiges
Reinigungsverfahren realisiert. In der ersten Stufe erfolgt die Adsorption
von STV an bestimmten Polymeren (solchen mit räumlich globularer Struktur/RGS).
In der zweiten Stufe werden die bei der Regeneration der
RGS-Adsorberkolonnen anfallenden Stoffverbindungen einem mikrobiellen
Abbau unterzogen. Dieses Konzept stellt eine Alternative zu
konventionellen Reinigungsverfahren auf der Basis von Aktivkohle dar.
Für die Optimierung der verschiedenen Reinigungsschritte muss eine
leistungsfähige problemorientierte Analytik eingesetzt werden. Die
Herausforderung für die analytische Verfahrensentwicklung liegt in der
großen Breite der zu untersuchenden Verbindungen, die durch
Stoffumwandlung der primären STV gebildet werden. Analytische Verfahren
mit hoher Selektivität und ausgezeichnetem Nachweisvermögen sind
erforderlich, um bisher nicht geklärte Stoffumwandlungswege zu
untersuchen. Die Entwicklung eines neuen Analysenverfahrens soll klären
helfen, ob Hydrazine (Verbindungen von Stickstoff mit Wasserstoff) als
Abbauprodukte des Sprengstoffs Hexogen gebildet werden.
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützte
Projekt wird von der Universität Leipzig in Kooperation mit Partnern der
Universität Hamburg sowie den Firmen Utt-Umwelttechnologietransfer GmbH
(Berlin) und UTS-Umwelttechnik- und Sanierungsgesellschaft mbH (Potsdam)
durchgeführt.
Wassermänner und Wasserfrauen im Imax
Preisverleihung Kreativwettbewerb
Wien (pts/19.04.2005/17:26)
- Rund 250 Schüler und Schülerinnen kamen am 19. April ins IMAX Wien um
bei der Preisverleihung des Kreativwettbewerbes "Wassermänner und
Wasserfrauen" dabei zu sein.
Dieser Kreativwettbewerb fand im Rahmen der "Wasserwochen" im IMAX
statt, bei denen sich 5.000 Schüler und Schülerinnen IMAX - Filme zum
Thema Wasser angesehen haben.
Der Wettbewerb wurde in Kooperation mit den Wiener Wasserwerken und dem
Pädagogischen Institut der Stadt Wien durchgeführt. Fast 600 Arbeiten
wurden eingereicht und der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt: Collagen,
Fotografien, Crash-Techniken, Modelle aus Ton oder Wachsmalkreiden kamen
zum Einsatz.
Die Bewertung erfolgte in den Kategorien Volksschulen, Kooperative
Mittelschulen, Sonderpädagogische Zentren und erstmalig gab es einen
Zusatzpreis für besondere Originalität und Ausführung. Die Jury bestand
aus Vertretern des PI Wien - hauptsächlich aus dem Bereich der
Bildnerischen Erziehung.
Der Chef der Wiener Wasserwerke DI Hans Sailer betonte die Aufgabe der
Wasserwerke "sich nicht nur um den technischen Ablauf der Wasserversorgung
zu kümmern, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen das richtige
Bewusstsein im Umgang mit Wasser zu schaffen".
Der österreichische Wetterexperte und Wissenschaftsjournalist Andreas
Jäger stellte im Rahmen der Preisverleihung sein neues Buch "Carlas
wunderbare Wetterreise" vor und überreichte den Siegerklassen auch gleich
ihre Gewinne.
Anammox-Bakterien entfernen Stickstoff aus Ozean
Pressemitteilung Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie,
18.04.2005 19:40
Stickstoffverbindungen sind der Dünger, der die
Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen mit kontrolliert, und dadurch die
Grundlage für alle Lebensformen auf der Erde darstellt. Das Meer verliert
aber ständig an Stickstoff, weil besondere Bakterien es abbauen und als
Stickstoffgas in die Atmosphäre freisetzen. Mit ausgefeilten
Analysetechniken konnten Bremer Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für marine Mikrobiologie zusammen mit ihren niederländischen Kollegen von
der Universität Nijmegen jetzt vor der Küste Namibias einem bisher
ungeklärten Phänomen im Stickstoffhaushalt des Meers auf die Spur.
In den sauerstoffarmen Gebieten des Ozeans ist ein mikrobieller Prozess
am laufen, der für 30 bis 50% der globalen Verluste an stickstoffhaltigen
Nährstoffen aus dem Meer verantwortlich ist. In der neuesten Ausgabe des
hoch angesehen Fachblatts Proceeding of the National Academy of Science (PNAS)
erklären sie, dass dieser Prozess nicht wie lange angenommen über die
Denitrifikation abläuft, sondern überraschenderweise unter Ausschluß von
Sauerstoff mit Hilfe von Anammox-Bakterien geregelt wird. Die vor Namibia
jetzt entdeckten Bakterien sind den Forschern keine Unbekannten. Kuypers
und seine Kollegen wiesen sie schon 2003 im Schwarzen Meer nach, jetzt
wurden sie auch im Ozean fündig.
Vor Namibias Küste sorgt der Benguela-Strom durch sein Auftriebssystem
für Nachschub von Nährstoffen, die für einen reich gedeckten Tisch sorgen.
Hier bedienen sich nicht nur die kleinen Fische, auch große Wale kommen
hierher. Die Anammox-Bakterien entfernen einen Großteil des Ammoniums aus
dieser Nahrungskette, das dabei freiwerdende Stickstoffgas entweicht in
die Atmosphäre und nur ein geringer Bruchteil davon kann von
Cyanobakterien und Algen wieder eingefangen und wieder ins System
eingeschleust werden.
Die Forscher fuhren eine ganze Batterie an Analysemethoden auf, um
dieses Puzzle zu lösen. Mit einer einzigartigen Kombination von
mikrobiologischen Techniken wie hochauflösenden Nährstoff- und
Lipidprofilen, isotopenmarkierten Fütterungsexperimenten und
molekularbiologischen Techniken wie Fluoreszenzmikroskopie gelang es ihnen
nachzuweisen, dass diese Bakterien in den sauerstoffarmen Zonen in 100
Meter Wassertiefe für die Beseitigung von diesem Nährstoff verantwortlich
sind.
Diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen für das
wissenschaftliche Verständnis des Stickstoffkreislaufs. Die mathematischen
Modelle, die die globale Stickstoffbilanz beschreiben, müssen jetzt
revidiert werden, denn dieses neu entdeckte "Leck" hat direkten Einfluss
auf die Berechnung des Kohlenstoffkreislaufs und damit auf langfristige
Klimaabschätzungen.
Denitrifikation
Die Ergebnisse widerlegen die bisherigen Vermutungen, dass die
sogenannte Denitrifikation (Umsetzung von Nitrat über Nitrit mithilfe von
organischer Materie und Bakterien zu Stickstoffgas) für die Freisetzung
von Stickstoff alleine verantwortlich ist.
Neue Spezies
Die Anammox-Bakterien aus dem Atlantik sind nahe Verwandte der Spezies
aus dem Schwarzen Meer (Kuypers et al, Nature, 8 April 2003). Sie
enthalten ebenfalls die einzigartigen leiterförmigen Moleküle (Ladderane),
die in der Membran einer Organelle über Ätherbrücken verankert sind und
diese so stabilisieren. Hier läuft die Umsetzung von Ammonium zu
Stickstoffgas ab. Ähnliche Strukturen kannte man bisher nur bei den
"Urbakterien", den Archaeen.
Abwasserreinigung in Kläranlagen
Der Anammox-Prozess ist nicht nur von akademischem Interesse, sondern
bietet eine vielversprechende Alternative zu der klassischen Methode in
Kläranlagen, Stickstoffverbindungen zu entfernen. Die Kosten reduzieren
sich auf ca. 10% und gleichzeitig verringert sich der Ausstoß des
Treibhausgases Kohlendioxid um 88%. In Rotterdam setzte man diese
Erkenntnisse jetzt um und nahm die weltweit erste auf Anammox-basierende
Großkläranlage in Betrieb.
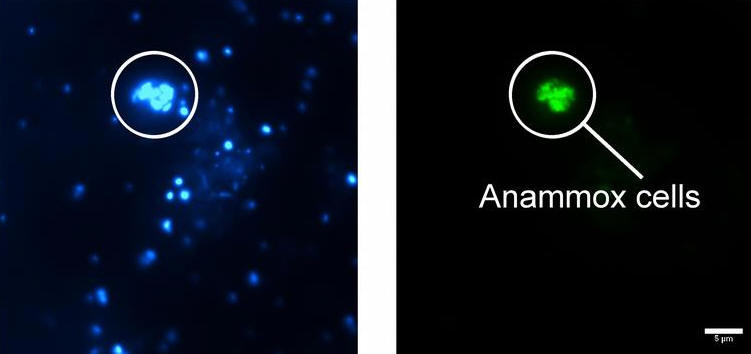
Fluoreszenz-Mikroskopie der Anammox-Bakterien. Rechts die spezifisch
angefärbten Anammox-Bakterien, links erkennt man alle Mikroorganismen in
der Probe.
Wasser für Beijing mit Ilmenauer Systemtechnik
Pressemitteilung Technische Universität Ilmenau, 18.04.2005 15:04
Ob Wasser- und Energiemanagementsysteme oder der Tauchroboter "Seebär"
- die Systemtechniker der TU Ilmenau und des Fraunhofer AST Ilmenau haben
mit ihren Forschungsergebnissen schon oft von sich reden gemacht. Mit dem
deutsch-chinesischen Großprojekt "Management- und Entscheidungshilfesystem
zur Verteilung der Wasserressourcen in der Region Peking" stellen sie sich
jetzt Herausforderungen von ganz neuer Dimension.
Gemeinsam mit dem Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB
Karlsruhe, dem Fraunhofer Representative Office Beijing (Peking) und der
Beijing Water Authority (BWA) haben die Ilmenauer Wissenschaftler um
Professor Jürgen Wernstedt die gewaltige Aufgabe übernommen, die
Wasserversorgung im Großraum Peking zu sichern. Das Forschungsvorhaben
wird vom BMBF und dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und
Technologie mit insgesamt acht Millionen Euro gefördert.
Ein derart komplexes Vorhaben wurde von den Wissenschaftlern aus
Ilmenau bisher noch nicht bearbeitet. Professor Jürgen Wernstedt: "Das
Projekt verbindet erstmals die umfassenden Erfahrungen der chinesischen
Partner bei der Bewirtschaftung extrem großer Wasserversorgungsgebiete mit
den Kompetenzen der Ilmenauer und Karlsruher Ingenieure und
Wissenschaftler bei der Entwicklung von Computersimulationen und
Entscheidungshilfesystemen für hydrologische Systeme sowie für
Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungssysteme. Wir sind stolz darauf, an
diesem bedeutendem bilateralen Forschungsvorhaben mitwirken zu können."
Projektziel ist die Entwicklung eines Entscheidungshilfesystems für die
optimale Versorgung der im Großraum Peking lebenden rund 16 Millionen
Menschen sowie der hier ansässigen Industrie und Landwirtschaft. Insgesamt
werden in Peking jährlich mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt.
Mit welchen Größenordnungen es die Forscher dabei zutun haben, erläutert
Gruppenleiter Dr. Thomas Rauschenbach: "Das Versorgungsgebiet umfasst mit
16.000 Quadratkilometern etwa die Fläche Thüringens, dies jedoch mit der
achtfachen Einwohnerzahl und außerdem zahlreichen Talsperren, Flüssen,
Kanälen, Rohrleitungssystemen, Oberflächen- und Grundwasserwerken sowie
leistungsstarken Pumpstationen. Hinzu kommen besondere topografische und
klimatische Bedingungen mit langen Trockenzeiten auf der einen und
Hochwassergefahren auf der anderen Seite sowie einer bis an die Grenzen
ausgeschöpften Wasservorhaltung. Unsere Aufgabe ist es, durch Planung,
Simulation und Kalkulation ein Wasserkreislauf-System aufzubauen, das -
schritthaltend mit der Bevölkerungsentwicklung - den Bedarf an Wasser
langfristig deckt."
Die Vorbereitungszeit für das Großprojekt betrug fast drei Jahre. In
dieser Zeit fanden zahlreiche gegenseitige Besuche in China und
Deutschland statt. Nachdem Ende Februar der Projektstart erfolgte, richten
die Forscher ihr Augenmerk nun besonders auf Meilensteine wie die
Sicherung der Wasserversorgung zu den Olympischen Sommerspielen 2008 in
Peking. Ein weiteres Etappenziel soll bis 2010 mit der Einbindung eines
großen Kanals in das Wasserversorgungssystem von Peking erreicht werden.
Dabei ist Wasser des Yangtse über eine Entfernung von mehr als 1000
Kilometern zuzuleiten. Darüber hinaus stehen Projekte für eine gezielte
Abwasseraufbereitung für die Landwirtschaft und eine natürliche Reinigung
des Abwassers auf dem Plan.
Mehr als die Hälfte der Flüsse fließen nicht
mehr
Globale Zerstörung der fließenden Binnengewässer dramatisch
Umea/Boulder (pte/15.04.2005/12:10)
- Von den großen Strömen der Erde sind mehr als die Hälfte in Dämme
gezwungen und fließt nicht mehr. Ein Forscherteam der schwedischen
Universität von Umea http://www.umu.se
hat die großen Flüsse genau untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass
die Folgen des Dammbaus massive Auswirkungen auf die Umwelt haben, denn
Fließgeschwindigkeit und Bodenerosion hängen damit zusammen, berichtet das
Wissenschaftsmagazin Nature
http://www.nature.com .
Das Team um Christer Nilsson hat die 292 großen Flusssysteme der Welt
untersucht. 172 dieser Flüsse sind durch Dämme beeinträchtigt, in Europa
sind es sogar mehr als 60 Prozent. Einzige Ausnahmen bildet die
vergleichsweise dünn besiedelte Region Australiens, Neuseelands und der
pazifischen Inselwelt. Dort sind nur 17 Prozent der Flusslandschaften
durch Dämme verändert. Die Veränderungen für die umliegenden Regionen und
für die Flüsse selbst beschreibt auch der Wissenschaftler James Syvitski
von der University of Colorado in Boulder. Die Dämme verhindern nämlich,
dass abgelagerte Sedimente von den Flüssen ins Meer transportiert werden.
In den Mündungen der Flüsse entstehen dadurch häufig schwere Schäden durch
Erosion. Ein Beispiel hierfür ist das Mississippi-Delta.
Nach Nilssons Angaben sind insbesondere für Südasien und Südamerika
gewaltige Staudämmprojekte vorgesehen. Alleine am Yangtse-Fluss in China
sind neben dem umstrittenen Drei-Schluchten-Projekt 49 weitere Dämme
geplant. "Wenn Menschen das globale Bild der zerstörten Flusslandschaften
sehen, agieren sie anders", so der Experte. Echte natürliche Flussläufe
werden immer seltener. Die Wissenschaftler hoffen, dass insbesondere bei
den geplanten aber heftig umstrittenen Großprojekten ein Umdenken
einsetzt. Auch der britische Wissenschaftler Mike Dunbar vom Centre for
Ecology and Hydrology in Wallingford hofft, dass die Forschungsergebnisse
wie ein Weckruf wirken.
Weitere Informationen: World Commission on Dams
http://www.dams.org
Pressemitteilung Freie Universität Berlin, 14.04.2005 12:20
In seltenen Fällen muss auch der Feind eines Freundes geschützt werden.
So verhält es sich mit den Protozoen, die sich im Klärschlamm tummeln und
dort die Bakterien fressen, die die eigentliche Abwasserreinigung
besorgen. Dr. Wilfried Pauli, Biologe an der Freien Universität Berlin,
hat dazu einen Test entwickelt, mit dem die Schädlichkeit von neuen
Produkten auf die Protozoen gemessen werden kann, und zwar bevor es zu
spät ist, so wie es die EU fordert. Doch bevor das neue Verfahren
eingeführt werden kann, muss bewiesen sein, dass es vom Nordkap bis nach
Sizilien die gleichen Ergebnisse bringt. Deshalb beginnt im Mai ein so
genannter Ringtest.
Die Protozoen sind sozusagen die Fresser der Fresser. Wenn sie die
Bakterien nach getaner Reinigungsarbeit nicht entsorgen, arbeitet ein
Klärschlamm nicht mehr richtig. "Das geschieht immer wieder, dann wird das
Abwasser nicht mehr gereinigt und verschmutzt die Umwelt", sagt Wilfried
Pauli. Das ist nicht nur ökologisch bedenklich, sondern auch ein
finanzielles Problem für die Kläranlagen. Sie müssen Strafen zahlen, wenn
sie mehr organisches Material in die Flüsse leiten als erlaubt ist. Trotz
des Risikos und damit auch handfesten Interesses der Wasserbetriebe
existiert bisher kein Test, mit dem neue Chemikalien darauf geprüft werden
können, ob sie die Protozoen angreifen. "Das Problem ist", so Wilfried
Pauli, "dass wir die Funktion einerseits im sehr komplexen natürlichen
Lebensraum testen müssen, andererseits aber einfach erfassbare Indikatoren
brauchen." Deshalb benutzt der Test den so genannten Belebtschlamm, der in
Kläranlagen anfällt, in ganz Europa verfügbar ist, und solch einen
funktionierenden Bakterien-Protozoen Lebensraum darstellt. Dazu gibt
Wilfried Pauli die Chemikalie, deren Schädlichkeit untersucht werden soll.
Der Clou ist nun, dass der Wissenschaftler die Bakterien nicht etwa mit
organischem Material füttert, um die Nahrungskette über die Bakterien zu
den Protozoen in Gang zu setzen. Denn dann würde zum Beispiel die
Vermehrung der Bakterien das Ergebnis verfälschen. Stattdessen gibt er
neue inaktivierte Bakterien dazu. Sie trüben das Wasser, bis sie von den
Protozoen abgebaut werden. Das geschieht allerdings nur, wenn die
Protozoen nicht durch die Chemikalien angegriffen worden sind. Die
Wassertrübung ist damit ein Indikator für die Schädlichkeit der
Chemikalien auf diese Mikroorganismen.
Damit ein Test europaweit offiziell eingeführt werden kann, muss er für
die Chemikalien-Kontrolleure überall nachvollziehbar sein, nach genau
festgelegten Richtlinien ablaufen und unabhängig von Klima oder
Laborausstattung zum gleichen Ergebnis führen. "Ich muss zeigen, dass, was
ich entwickelt habe, überall klappt", sagt Wilfried Pauli. "Jetzt legen
wir das Vorgehen fest und ab Mai beginnt dann der Ringtest in mehreren
europäischen Ländern." Er soll Mitte 2006 abgeschlossen sein.
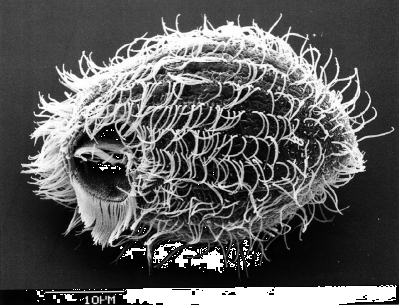 Mit diesem
kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst
eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in
Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im
Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In
den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können
bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena. Mit diesem
kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst
eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in
Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im
Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In
den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können
bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.
© Christian Bardele, Universität Tübingen
Schritt für Schritt: Umweltmanagement in kleinen
und mittleren Unternehmen
Pressemitteilung Umweltbundesamt (UBA), 12.04.2005 13:47
Umweltbundesamt (UBA) und Bundesumweltministerium (BMU) veröffentlichen
neue Broschürenreihe im Internet
Die Einführung eines Umweltmanagements bringt auch in kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) wirtschaftliche Vorteile. Sie sparen zum
Beispiel Energie sowie Material. Zudem gibt es einen Imagegewinn. Das
belegen zahlreiche Beispiele aus der Praxis. Dennoch scheuen sich viele
KMU vor einem solchen Schritt. Ihnen fehlt oftmals die Zeit, das Wissen
und das Geld, ein systematisches Umweltmanagement im Betrieb umzusetzen.
Die neue Broschürenreihe "Schritt für Schritt ins Umweltmanagement"
leistet einen Beitrag, diese Einstiegshürden zu verringern. Sie stellt
Konzepte vor, die sich in der Praxis bewährten. Mit deren Hilfe können die
Unternehmen ein Umweltmanagement stufenweise und mit geringem Aufwand
aufbauen. Selbst das hohe Niveau des Umweltmanagementsystems EMAS lässt
sich auf diese Weise in kleinen, praktikablen Schritten erreichen.
In der neuen Veröffentlichungs-Reihe erschienen bisher vier Broschüren,
die auf den Internetseiten des UBA und des BMU zum Herunterladen
bereitstehen. Sie stellen jeweils einen Umweltmanagementansatz vor, der
sich besonders gut für den Einstieg in ein systematisches
Umweltmanagementsystem eignet. Es sind: das "Umweltsiegel des Handwerks",
das "Ecomapping"-Konzept, die im kirchlichen Bereich erfolgreich
angewandten Ansätze "Grüner Gockel/Grüner Hahn" sowie das "Ecocamping"-Konzept,
das speziell für Camping-Unternehmen nutzbar ist. Auf den Internetseiten
des UBA finden Sie die Veröffentlichungen unter den Links:
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2877.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2878.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2879.pdf
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2880.pdf
Die Broschüren informieren über Aufwand und Nutzen der Konzepte sowie
den schrittweisen Aufbau des Umweltmanagements. Außerdem geben sie Tipps
zu Finanzierungsmöglichkeiten.
scienceticker.info 12.4.2005
Nach der Klärung wird Abwasser immer häufiger mit ultraviolettem Licht
bestrahlt, um noch vorhandene Krankheitserreger unschädlich zu machen.
Eine besonders effektive UV-Quelle wurde nun im Rahmen eines EU-Projektes
entwickelt. In ihr wird zunächst ein extrem heißes Plasma erzeugt, das
dann die energiereiche Strahlung abgibt.
Gegen Mikroben hilft UV-Licht: Bei ausreichender Dosierung schädigt
Strahlung mit einer Wellenlänge um 254 Nanometer das Erbgut von Bakterien,
Pilzen und Viren derart, dass die Keime sich nicht mehr vermehren können.
Nicht nur Krankenhäuser, sondern immer häufiger auch kommunale Kläranlagen
setzen auf die Bestrahlung des Abwassers. Allerdings wird bei
herkömmlichen Quecksilberdampflampen maximal ein Drittel der
hineingesteckten Energie in Form von UV-Licht abgestrahlt, der Rest
erwärmt das Wasser lediglich. Zudem beträgt die Lebensdauer dieser Lampen
im Dauerbetrieb weniger als ein Jahr.
Ohne verschleißanfällige Elektroden kommt dagegen ein UV-Strahler aus,
den Anja Flügge von der Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe in
Stuttgart und ihre Kollegen aus vier europäischen Ländern entwickelt
haben. Darin wird Mikrowellen-Strahlung über Zuleitungen in eine Kammer
geleitet und reißt Elektronen und Atomkerne einer darin enthaltenen
Gasmischung auseinander. Erst das so erzeugte Plasma strahlt
ultraviolettes Licht ab. "Wichtig ist die Zusammensetzung des Gases",
erklärt Flügge, "denn darüber können wir - im Gegensatz zu herkömmlichen
Lampen - die Wellenlänge der emittierten Strahlung in gewissen Grenzen
einstellen." Die UV-Quelle könne so an verschiedene Keimarten angepasst
werden.
Entwickelt wurde das Strahlerkonzept im Rahmen des EU-Projektes "PlasLight".
Bei dem derzeit am weitesten entwickelten Prototyp geht die UV-Strahlung
durch zwei 40 mal 40 Zentimeter große Quarzfenster auf das vorbeiströmende
Wasser über. Eingebettet ist die Quelle in einen mobilen Versuchsstand,
sodass sie sich vor Ort an unterschiedlichen Abwässern testen lässt.
Die Geldquelle - Das Milliardengeschäft mit dem
Wasser
3sat-online 12.4.2005
Sorina lebt mit ihren 6 Kindern in einem Slum in Manila. Die Cholera
haben sie nur knapp überlebt. Das verschmutzte Leitungswasser hatte sie
infiziert. Mineralwasser in Flaschen kann sich Sorina nicht leisten.
Manila, die Metropole der Philippinen, hat die staatliche Wasserversorgung
privatisiert und internationale Konzerne übernahmen das Wassergeschäft.
Sie versprachen sauberes, billiges Wasser und neue Anschlüsse - doch
stattdessen explodierten die Preise und die Qualität sank. Nach
UNO-Angaben mangelt es weltweit mehr als 1,1 Milliarden Menschen an
sauberem Wasser, was zu mehr als drei Millionen Todesfällen im Jahr führt.
In den Slums von Manila
Dieses Wasserchaos droht in Deutschland nicht. Aber auch hier verkaufen
immer mehr Kommunen ihr Wasser an große private Wasserversorger. Zum
Beispiel Berlin, das sich für 1,7 Milliarden Euro die Hälfte seiner
Wasserversorgung von den "global player" RWE und Veolia abkaufen ließ.
Seit 2004 müssen die Berliner 15 Prozent mehr Gebühren zahlen, in diesem
Jahr kommen noch mal 5,4 Prozent dazu, denn RWE/Veolia wurde für 29 Jahre
eine Rendite von 8 Prozent pro Jahr garantiert.
Auch in Buenos Aires hat die Privatisierung zu exorbitant steigenden
Preisen geführt, genauso wie in Teilen Uruguays. Zwar ist dort in der
Verfassung festgeschrieben, dass Trink- und Abwassersysteme ausschließlich
öffentlich betrieben werden dürfen, doch Präsident Tabaré Vázquez sieht
keinen Anlass, den europäischen Wasserkonsortien Aguas de la Costa ( =
Suez aus Frankreich) zu kündigen. Seitdem die Wasserversorgung des
Küstenstreifens nördlich von der Touristenhochburg Punta del Este
privatisiert wurde, stieg der Preis auf das 7 bis 16-fache des
uruguayischen Durchschnitts und kostenlose Wasserstellen wurden
abgeschafft. Dass vor allem die Franzosen eine Vorreiterrolle auf dem
Gebiet der privaten Wasserversorgung innehaben, ist kein Zufall: Acht von
zehn Franzosen beziehen ihr Wasser von einem privaten Anbieter. Auch in
Frankreich ist das nicht unumstritten, denn nur drei Konzerne machen den
größten Teil des Geschäftes. Ihr Vorgehen ist oft dubios: mangelnde
Transparenz der Vertragsinhalte, saftige Preiserhöhungen und
Monopolpraktiken. Die Gemeinden sind nicht in der Lage, die von den
Privatunternehmen erstellten Rechnungen auf sachliche Richtigkeit zu
prüfen. Solche Missstände, die seit Jahren durch öffentliche
Untersuchungen aufgedeckt wurden, zeigen zweifellos eine Form der
strukturellen Korruption.
Demonstration für sauberes Trinkwasser
Deswegen wächst in vielen Städten der Widerstand gegen den Ausverkauf
des guten Wassers. Wasser ist zum Top-Thema der Globalisierungsdiskussion
geworden. Trinkwasser muss in öffentlicher Kontrolle bleiben, fordern die
Privatisierungsgegner. Wasserleitungen sind immer nur Einmal vorhanden,
echte Marktwirtschaft könne es nicht geben, so die Kritiker. Deswegen sei
hier die Monopolisierung vorprogrammiert. "Wasser ist Lebensgrundlage und
nicht fürs Börsenmonopoly".
Doch Multis wie Nestlé oder Danone haben es längst geschafft, Europäer
und Amerikaner "an die Flasche" zu bringen. Mineralwasser ist ein
Boomprodukt. Statt billigeres Wasser aus dem Hahn trinken wir Deutschen
allein mehr als 120 Liter Evian, Vittel oder etwa Gerolsteiner pro Jahr
und bezahlen gerne das Hundertfache dafür. Flaschenwasser verspricht
Jugend, Fitness und ist ein Produkt mit lukrativer Gewinnspanne, vor allem
in den Schwellenländern, wo die Wasserversorgung den Menschen kein
trinkbares Wasser zu liefern vermag.
Filmhinweis und bebilderter Text sowie Literaturhinweise bei
3sat
Die Versorgung mit frischem Nass und sauberen sanitären Anlagen ist
weltweit noch ungenügend / Von Jürgen Trittin
Frankfurter Rundschau 11.4.2005
1,1 Milliarden Menschen haben noch keinen geregelten Zugang zu einer
angemessenen Wasserversorgung und fast 2,6 Milliarden leben ohne Zugang zu
jedweder Sanitärversorgung. Das Monitoring-Programm von WHO und Unicef hat
festgestellt, dass es bis 2002 gelungen ist, gut 83 Prozent der
Weltbevölkerung den Zugang zu einer geregelter Wasserversorgung zu
ermöglichen. Das entspricht einem zusätzlichen Anschluss von 1,1
Milliarden Menschen seit 1990 und ist zweifellos ein großer Erfolg
einzelner Staaten und internationaler Kooperation. Allerdings haben nicht
alle Regionen große Fortschritte gemacht. Im Afrika südlich der Sahara
haben nur 58 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Sehr viel geringer sind die Fortschritte bei der sanitären
Grundversorgung. Diesen Zugang hatten 2002 weltweit nur 58Prozent. Die
Steigerung gegenüber 1990 betrug nur neun Prozent. Auch hier sind die
Zahlen für Afrika südlich der Sahara und für Südasien deutlich geringer.
Vor allem Bewohner ländlicher Regionen und urbane Arme, insbesondere
Slumbewohner, müssen unter sehr viel schlechteren Bedingungen leben.
Rechnet man das Bevölkerungswachstum ein, müssen wir bis 2015 für 1,5
Milliarden Menschen Zugang zu sauberem Wasser schaffen - also jeden Tag
für 274 000 Menschen. Für circa zwei Milliarden müssen bis 2015
grundlegende Sanitäreinrichtungen bereitgestellt werden - also für 370 000
täglich. Wenn wir keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, würden wir 2015
das Entwicklungsziel im Sanitärsektor um mehr als 500 Millionen verfehlen.
Und nicht nur das: Auf dem Millenniumsgipfel hat die
Staatengemeinschaft unter dem übergreifenden Ziel der Armutsbekämpfung
acht prioritäre Handlungsfelder verabschiedet, die z.T. sehr eng mit der
Wasserpolitik verbunden sind.
Wo stehen wir?
Ziel Nr. 1, die Bekämpfung absoluter Armut, ist ohne Zugang zu Wasser
nicht möglich.
Auch Ziel Nr. 2, grundlegende Bildung für alle Mädchen und Jungen,
können wir ohne Wasser- und Sanitäreinrichtungen in Elternhäusern und
Schulen nicht erreichen. Ohne gut funktionierenden Wasserzugang in der
Nähe müssen die Töchter über weite Strecken Wasser nach Hause schleppen -
statt zur Schule zu gehen.
Ziel Nr. 4, die Reduzierung der Kindersterblichkeit, ist nur möglich,
wenn wir den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung verbessern.
Ziel Nr. 7, ökologische Nachhaltigkeit, kann ohne richtig
bewirtschaftete Wasserressourcen nicht gelingen. (...)
Dass 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
haben, liegt in den meisten Regionen nicht an Süßwassermangel, sondern
daran, dass bestimmte Gruppen zu viel für sich beanspruchen oder es ohne
Rücksicht auf Mensch und Natur verschmutzen. 70 Prozent des Süßwassers
wird in der Landwirtschaft verbraucht bzw. vielfach in ineffizienten
Bewässerungssystemen verschwendet. Einmal entstandene Schäden am Ökosystem
zu beheben, erfordert enorme Anstrengungen und Kosten. Wüsten wieder
fruchtbar zu machen, kann zwar gelingen - wie in Rajasthan (Indien) mit
der Anlage traditioneller Seen. Es erfordert aber viel know how und ein
großes Engagement der lokalen Bevölkerung.
Gefordert sind daher rasches und entschlossenes Handeln, um solche
gravierenden Schädigungen des Ökosystems zu begrenzen oder zu vermeiden.
Denn Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Es ist durch nichts
substituierbar! Die Bundesregierung begrüßt sehr, dass der
Sozialpakt-Ausschuss des Ecosoc im November 2002 erklärt hat, dass der
Zugang zu Trinkwasser, zu Wasser für hygienische Zwecke und zur
Nahrungsmittelproduktion Menschenrecht im Sinne des Pakts über soziale und
wirtschaftliche Menschenrechte ist.
Das Bevölkerungswachstum, das vielerorts die erreichten Verbesserungen
relativiert, ist nur eine Schwierigkeit bei der Erreichung der
Entwicklungsziele. Die weltweit zunehmende Verstädterung verstärkt den
Druck auf die Wasserressourcen. Wir müssen intelligente Lösungen
entwickeln, um trotzdem eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu
gewährleisten. In 35 Jahren werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in
Städten leben. Wir verschwenden und belasten Wasser durch Landwirtschaft,
Industrie, Bergbau und Handwerk, weil Wasser allzu oft ein low cost-Faktor
ist. Die Zahl der Wasserschadensgebiete wächst. (...)
Das gängige Leitbild von Wohlstand führt zu verschwenderischen
Konsumgewohnheiten. Mancherorts sind Rasensprenger und ein Swimmingpool
Statussymbole. Sind Parkanlagen wie auf den Britischen Inseln auch in
ariden Regionen sinnvoll? Nachhaltige Wasserbewirtschaftung braucht
kulturelle Vielfalt statt globaler Monokultur.
Wirtschaftliche Entwicklung erhöht den Wasserbedarf. Eine neue
Weltbankstudie prognostiziert, dass der jährliche Wasserbedarf in China
sich von heute 120 Milliarden Tonnen auf 400 Milliarden Tonnen in 2030
steigern wird. Schon jetzt fallen in China - u.a. wegen der 80 000
Staudämme - jedes Jahr im Schnitt 2000 Seen und Flüsse trocken. Selbst ein
so großer Strom wie der Gelbe Fluss erreicht inzwischen monatelang nicht
mehr das Meer.
Hinzu kommt der Klimawandel. Er wirkt sich unmittelbar und massiv auf
den Wasserhaushalt der Erde aus, nicht nur in Form von Dürren. Starkregen
füllen kaum die Süßwasserspeicher auf, sondern schwemmen stattdessen sogar
die fruchtbare Erdkrume weg. Der Klimawandel wird regionale
Wasserhaushalte drastisch verändern, selbst wenn die Erhöhung der globalen
Durchschnittstemperatur unter zwei Grad bleibt. Die Veränderung regionaler
Wasserkreisläufe würde Megastädte in asiatischen Entwicklungsländern
derart stark in Mitleidenschaft ziehen. Weltweit würden mehr als zwei
Milliarden Menschen zusätzlich unter Wasserknappheit leiden müssen.
All diese Faktoren führen dazu, dass sich die Wasserkrise ohne
geeignete Gegenmaßnahmen weiter verschärft. Gewalttätige Konflikte um
Wasser sind heute Realität. (...) An der Grenze zwischen Kenia und
Äthiopien starben 30 Menschen in einem Konflikt um Wasser, rund 30 000
wurden vertrieben. Forscher gehen davon aus, dass in 30 Jahren die Hälfte
der Menschheit in stark wassergefährdeten Gebieten leben wird. Die Zahl
der Umweltflüchtlinge wird sich in den nächsten 20 Jahren auf 100
Millionen vervierfachen. Ziel muss angesichts all dieser wachsenden
Gefahren sein, grenzüberschreitende Wasserläufe zum Anlass für Kooperation
zu machen, z.B. internationalen Kommissionen für eine gerechte
Wassernutzung zu vereinbaren.
Die Komplexität und die Bedeutung dieser zwei Entwicklungsziele machen
es zwingend,
- alle Akteure aktiv einzubinden - seien es die lokalen
Wasserkonsumenten, die lokale Verwaltung, zivilgesellschaftliche
Initiativen, nationale Regierungen oder internationale Organisationen;
- Wasser- und Sanitärfragen hohe Priorität auf allen Ebenen des
Handelns zu geben;
- durch ökologisch verantwortungsvolle Bewirtschaftung der gesamten
Wassereinzugsgebiete eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.
Die Commission on Sustainable Development (CSD) muss auf ihrer 13.
Sitzung konkrete Maßnahmen in den Bereichen capacity-building,
Technologietransfer, gute Regierungsführung und Finanzierung vereinbaren
und das Konzept eines umfassenden Gewässerschutzes weiter fördern. Zur
Vorbereitung hat die Bundesregierung im Dezember 2004 hochrangige
internationale Experten eingeladen. Fünf Ergebnisse sind besonders
wichtig:
Was muss getan werden?
- Der Sanitärbereich muss oberste Priorität bekommen. Wenn Schulen und
Krankenhäuser in den ärmsten Regionen der Welt mit Sanitäreinrichtungen
ausgestattet werden, entstehen Synergieeffekte, da sich das positiv auf
Gesundheit und Bildung auswirkt. Priorität für den Sanitärbereich ist ein
Gebot der Geschlechtergerechtigkeit: Denn Mädchen und Frauen werden durch
unzureichende Sanitärversorgung in ihrer Würde verletzt und extrem in
ihren Aktionsmöglichkeiten eingeschränkt, behindert und z. T. sogar
gefährdet.
- Wasserversorgungsstrukturen müssen dezentral aus der lokalen oder
regionalen Gemeinschaft heraus aufgebaut und organisiert werden. Nur so
können sie auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region abgestimmt werden.
Wichtig sind Transparenz, Good Governance und angepasste Technologien.
Aufgrund unserer Erfahrungen mit kommunal organisierten
Versorgungsstrukturen kann Deutschland hier viel beitragen.
- Die finanzielle Unterstützung für eine funktionierende
Wasserversorgung muss aufgestockt werden. Die entsprechende Arbeitsgruppe
des Millennium Projekts hält es für notwendig, öffentlich und privat pro
Jahr insgesamt circa sieben Milliarden US-Dollar bereitzustellen.
Nationale Regierungen im Süden und die Geberländer müssen diesen
Entwicklungszielen mehr Priorität geben. Die Industriestaaten müssen sich
in ihrer Kooperation noch stärker auf arme Regionen und auf die Schicht
der absolut Armen konzentrieren. Die Bundesregierung hat im Sektor
Wasserwirtschaft bereits bewusst den Schwerpunkt auf Afrika gelegt. Auch
die Wasserinitiative der Europäischen Union (Euwi) konzentriert sich auf
Regionen in Afrika, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind. Die
Euwi stellt mit der EU-Wasser-Fazilität zusätzlich 500 Millionen Euro zur
Verfügung. Dazu trägt Deutschland 117 Millionen Euro bei.
Wer muss zahlen?
Notwendig ist aber auch, vor Ort kostendeckende Beiträge zu erheben.
Nur das stellt den langfristigen Betrieb sicher. Denn die Aufbereitung und
Verteilung von Wasser kostet ebenso Geld wie die Entsorgung von Abwässern.
Daher sollten die Nutzer, die bezahlen können, auch zahlen: also
Landwirtschaft, Industrie und finanziell besser gestellte Haushalte. Für
alle anderen Menschen muss der Zugang zu sauberem Wasser subventioniert
werden - so weit er der Sicherung von Grundbedürfnissen dient. (...)
Langfristiges Ziel ist, immer mehr Familien die Überwindung der Armut
zu ermöglichen und sie in den Kreis der Beitragszahler aufzunehmen. Wenn
die lokale oder regionale Gemeinschaft die Wasserdienstleistungen
gemeinsam kostendeckend finanziert, hat dies daher Vorteile gegenüber
einer privatisierten Wasserversorgung. Die lokale oder regionale
Gemeinschaft hat auch das größere Eigeninteresse an nachhaltiger
Wassernutzung, die spätere Generationen nicht übervorteilt. Sie hat - und
das ist mittelfristig besonders wichtig - auch den größeren Einfluss auf
eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftsweise im
Wassereinzugsgebiet.
Wie sieht die Zukunft aus?
- Die regionale Wasserver- und -entsorgung muss den gesamten Naturraum
zum Ausgangspunkt der Planung machen. Man kann lokal nicht sauberes Wasser
sicherstellen, wenn Industrie, Bergbau oder Landwirtschaft ringsum mit
Chemikalien freveln oder den größten Teil des Wassers abzweigen. Nur
intakte Ökosysteme können auf Dauer ausreichend gesundes Trinkwasser zur
Verfügung stellen. Deshalb muss ein guter Zustand der Gewässer von der
Quelle bis zur Mündung und im küstennahen Bereich sichergestellt werden.
Wie Oberflächen- und Grundwasser vor Ort zusammenspielen, muss bei allen
Planungen und technischen Lösungen bedacht werden. Umwelt- und
Gewässerschutz muss Querschnittsaufgabe werden.
- Da die Wasserkrise primär eine Governance-Krise ist, brauchen wir zur
Lösung kohärente Strategien und Instrumente der Umsetzung. Wasserfragen
sind ein Schlüssel für Entwicklung und müssen daher gezielter und stärker
in nationale Entwicklungspläne und Strategien zur Armutsbekämpfung
eingebunden werden. In Johannesburg wurde beschlossen, dass alle Staaten
bis 2005 Pläne für ein Sektoren übergreifendes Integriertes
Wasserressourcenmanagement (IWRM) und zur Steigerung der
Wasserressourceneffizienz erstellen soll. Die "Internationale Konferenz zu
IWRM" hat im Dezember 2004 in Tokio festgestellt, dass eine solche
grenzüberschreitende Zusammenarbeit mehr Zeit braucht, dass erste Schritte
aber in diesem Jahr erfolgen müssen. Wir brauchen rasche Fortschritte.
Zwei Aspekte müssen dabei von Beginn an einbezogen werden: Wir müssen die
Belastbarkeit des jeweiligen Gewässerbereichs berücksichtigen und wir
müssen die regionalen Auswirkungen des Klimawandels antizipieren. (...)
Der Autor
Jürgen Trittin, 1954 geboren, ist seit Oktober 1998 Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der rot-grünen Regierung.
Zuvor arbeitete der Grüne als Journalist und Diplomsozialwirt.
1990 bis 1994 war er niedersächsischer Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten und von 1994 bis 1998 Sprecher des Bundesvorstandes
der Grünen.
Die hier in Auszügen dokumentierten Positionen wird Trittin auf der 13.
Sitzung der Commission on Sustainable Development (CSD) vertreten. Die
Tagung der CSD - UN- Kommission zur nachhaltigen Entwicklung - beginnt am
heutigen Montag in New York. ber
Messinggefäße für Wasser können Krankheiten
verhindern
Entwicklungsländer: Plastik gewährleistet keine Sicherheit
R. Reed
Edinburgh (pte/11.04.2005/10:08)
- Messinggefäße für Trinkwasser bieten nach Angaben eines britischen
Mikrobiologen der Northumbria University
http://northumbria.ac.uk
wesentliche Vorteile gegenüber Plastik: in den Metallbehältern haben
Krankheitserreger wesentlich weniger Chancen als in denen aus Kunststoff,
berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature
http://www.nature.com . Besonders Erkrankungen von Erregern, die
im Wasser leben oder Wasser zum Leben brauchen, fordern jährlich etwa zwei
Mio. Todesopfer unter Kindern.
Der Mikrobiologe Rob Reed hatte auf einer Reise durch Indien die
"Weisheit der Ortsansässigen" mit großem Interesse aufgenommen, wonach
Messingbehälter besser wären als jene aus Kunststoff. Der Forscher hat
daraufhin Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, dass in
Messinggefäßen tatsächlich weniger Bakterien vorhanden waren als Tongefäße
oder Plastik. In weiteren Untersuchungen in Großbritannien hat der
Mikrobiologe entdeckt, dass bei Versuchen mit Escherichia-Coli-Bakterien
kontaminiertem Wasser die Zahl der lebenden Erreger nach 48 Stunden in
Messinggefäßen erheblich abgenommen hat. Grund dafür ist das im Messing
enthaltene Kupfer, das biologische Systeme offensichtlich stört.
Kupfer reagiert demnach mit den Membranen und Enzymen von Zellen. Für
Bakterien kann dies den Tod bedeuten, wie Reed anlässlich des
Jahrestreffens der Society for General Microbiology in Edinburgh erklärte.
Die Menge an abgegebenen Kupfer ist für den menschlichen Organismus
allerdings nicht gesundheitsschädlich, wie Reed ausführt. Selbst zehn
Liter Wasser aus solchen Behältern würde die tägliche maximal empfohlenen
Menge von Kupfer für den menschlichen Organismus nicht erreichen.
Plastik wird in vielen Entwicklungsländern als modern angesehen und ist
im Vergleich zu anderen Materialien relativ billig. Dennoch rät der
Wissenschaftler dazu, traditionellen Gefäßen den Vorzug zu geben. Eine
Spekulation darüber, wie viele Menschenleben durch den Einsatz von Messing
gerettet werden können, will der Forscher nicht abgeben. Der
Wissenschaftler sieht aber für die Messinggefäße ein großes Potenzial.
Ressourcen sparen durch Wassermanagement
Pressemitteilung Fraunhofer-Gesellschaft, 08.04.2005 12:12
Sauberes Wasser ist viel zu schade für die Kanalisation. Auf der IFAT -
vom 25. bis 29. April in München - präsentieren Fraunhofer-Forscher
praktische Lösungen, die den Verbrauch von Trinkwasser drastisch
reduzieren. Das wenige Abwasser, das übrig bleibt, lässt sich mit einer
dezentralen Aufbereitungstechnik in Brauchwasser, Energie und Dünger
verwandeln. "Wir müssen erst einmal im eigenen Land zeigen, was wir
können, bevor wir anderen etwas verkaufen wollen", sagt Prof. Walter
Trösch, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Der Rotationsscheibenfilter,
den er auf der IFAT zeigt, ist Kernstück einer neuen Klärtechnologie, bei
der Membranen äußerst effektiv Schlamm und Krankheitserreger aus dem
Abwasser herausfiltern. Noch in diesem Sommer wird eine erste
Membrankläranlage in Neurott bei Heidelberg in Betrieb gehen. Mit dem
Pilotprojekt wollen die Forscher demonstrieren, dass dezentrale
Abwasserentsorgung technisch machbar und ökonomisch sinnvoll ist. "Neurott
ist ein Beispiel für eine abgelegene Siedlung, bei der sich der Anschluss
an das öffentliche Kanalnetz nicht lohnt, weil das Verlegen der Leitungen
zu teuer wäre", erklärt Trösch. Neurott ist kein Einzelfall: Siedlungen
ohne Anschluss an die Kanalisation gibt es auf der ganzen Welt. In den
reicheren, technisch entwickelten Ländern werden die Abwässer in
Versitzgruben gesammelt, in den armen Regionen fließen sie ungeklärt in
den nächsten Bach oder Fluss. Trösch: "Die Membranklärtechnologie kann die
Abwasserprobleme nicht nur abgelegener Siedlungen lösen."
In Neurott werden jetzt Kanalrohre verlegt, durch die künftig das
Abwasser von den Häusern weg gepumpt wird. In einem alten Geräteschuppen
der Feuerwehr soll demnächst die semi-dezentrale Membrankläranlage
installiert werden, die 10 000 Liter Wasser am Tag reinigen kann. "Das
geklärte Wasser hat Badegewässerqualität und kann in den nahe gelegenen
Bach eingeleitet werden, ohne dass dies negative Folgen für die Umwelt
hätte", so Trösch. "Das neue Entsorgungskonzept kostet nicht mehr als die
Behandlung der Abwässer in Großkläranlagen. Gleichzeitig liefern
semi-dezentrale Anlagen qualitativ bessere Ergebnisse, weil die Membranen
Bakterien restlos herausfiltern." Das Konzept der dezentralen Entsorgung
entwickelte Tröschs Team im Projekt DEUS 21 - die Abkürzung steht für
Dezentrales Urbanes Infrastruktur-System - und wird gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF. Mit beteiligt sind neben
Forschern vom IGB auch Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung ISI sowie von der RWTH Aachen. Die
Abwasseraufbereitung ist dabei nur ein - wenn auch wichtiger - Teil des
umfassenden Wassermanagements. Der erste Schritt ist die Versorgung mit
sauberem Trinkwasser, wichtig ist weiter der sparsame Umgang mit dieser
Ressource und schließlich die Weiterverwertung der Abfallstoffe. Am
Römerweg, einem Neubaugebiet in Knittlingen bei Pforzheim, entsteht
derzeit eine Demo-Siedlung in der die Forscher vom Projekt DEUS 21 die
Stoffströme optimiert haben: Alle Häuser bekommen zwei Wasseranschlüsse -
einen für Trink- und einen für Brauchwasser. Das Brauchwasser wird vor Ort
aus Regenwasser gewonnen: Eine Membran filtert Keime heraus, das
gereinigte Nass erfüllt nun die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Da Regenwasser salz- und kalkfrei ist, eignet sich das "Pflegewasser" gut
zum Geschirr- und Wäschewaschen, für Dusche und Toilettenspülung oder zum
Blumengießen. Durch die Nutzung des Regenwassers wird der
Trinkwasserverbrauch drastisch reduziert. Aber das ist noch nicht alles.
In Knittlingen gibt es außerdem ein neues Entsorgungskonzept: Ein
Vakuumsystem saugt das Abwasser aus den Häusern kontinuierlich ab und
transportiert es zusammen mit dem Biomüll in das dezentrale Klärwerk am
Rand der Siedlung. Dort wird aus den Schmutzstoffen Biogas und hieraus
Energie gewonnen. Phosphor und Stickstoff werden separiert, sie lassen
sich zu Dünger weiterverarbeiten.
"Die beiden Projekte in Knittlingen und Neurott zeigen, dass eine
dezentrale Infrastruktur funktioniert", resümiert Trösch. "Wir werden die
Technik jetzt weltweit anbieten - als Gesamtkonzept oder in Form einzelner
Komponenten, die sich an die Bedürfnisse der Anwender anpassen lassen."
Auf der IFAT stellt Prof. Walter Trösch das Projekt DEUS 21 vor, bei einem
Vortrag im BMBF-Forum am 27.4. um 10.40 Uhr.
Wasser effizient entkeimen
Pressemitteilung Fraunhofer-Gesellschaft, 08.04.2005 11:08
Mikroben mit ultravioletter Strahlung zu sterilisieren, ist in vielen
Kläranlagen Usus. Wirkungsgrad und Lebensdauer der eingesetzten Strahler
bestimmen dabei, wie effizient eine Anlage arbeitet. Der Prototyp einer
verbesserten UV-Lichtquelle arbeitet mit Mikrowellen. Gegen Mikroben hilft
UV-Licht. Daher werden Abwässer - zum Beispiel aus
Tierkörperbeseitigungsanstalten oder Krankenhäusern - nach der Reinigung
in der Kläranlage zusätzlich noch mit UV-Licht bestrahlt. Auch Betreiber
kommunaler Kläranlagen setzen zunehmend diese Technik ein - insbesondere
dann, wenn sich in der Nähe Badegewässer befinden. Sogar zur Aufbereitung
von Trinkwasser und für Schwimmbäder ist dieses Entkeimungsverfahren
bewährt und elegant, zumal keine Chemikalien benötigt werden.
Ultraviolette Strahlung mit einer Wellenlänge um 254 Nanometer schädigt
das Erbgut von Bakterien, Pilzen und Viren derart, dass bei ausreichend
hoher Dosis nahezu alle Keime ihre Fähigkeit verlieren, sich zu vermehren.
Nachteil der zumeist verwendeten Quecksilberdampflampen: Ihre Leistung
fällt allmählich ab und die Lebensdauer liegt im Dauerbetrieb bei unter
einem Jahr. Mit Wirkungsgraden von 5 bis 35 Prozent erwärmt das Gros der
eingesetzten elektrischen Energie lediglich das Wasser. Ein neues Konzept
für einen UV-Lichtstrahler wurde im EU-Projekt "PlasLight" entwickelt. Da
der Strahler ohne verschleißende Elektroden auskommt, ist er besonders
langlebig. Projektpartner sind Unternehmen und Institute aus vier
EU-Ländern - darunter Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie ICT und von der
Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe TEG.
Die Funktionsweise der neuen UV-Quelle unterscheidet sich gänzlich von
herkömmlichen Lampen: Magnetrons erzeugen Mikrowellenstrahlung, die über
Zuleitungen eine Kammer erreichen. In der darin eingeschlossenen
Gasmischung entsteht ein Plasma, das dann UV-Licht abstrahlt. Im derzeit
am weitesten entwickelten Prototypen geht es durch zwei 40 x 40 Zentimeter
große Quarzplatten auf das vorbeiströmende Wasser über. "Wichtig ist die
Zusammensetzung des Gases", verrät Projektleiterin Anja Flügge, "denn
darüber können wir - im Gegensatz zu herkömmlichen Lampen - die
Wellenlänge der emittierten Strahlung in gewissen Grenzen einstellen.
Dadurch lässt sich die UV-Quelle auf verschiedene Keimarten anpassen."
Eingebettet ist der Strahler in einen mobilen Versuchsstand, der im
Wesentlichen aus einem oben offenen Kanal ("Gerinne") und der
UV-Lichtquelle besteht. So lässt sich bei Kunden das jeweilige Wasser
unter realen Bedingungen behandeln und untersuchen. Während der IFAT in
München präsentieren die Forscher ihre "PlasLight"-Anlage vom 25. bis 29.
April. Auf der "Leitmesse für Umwelt und Entsorgung" kann sie in Halle B2
besichtigt werden.
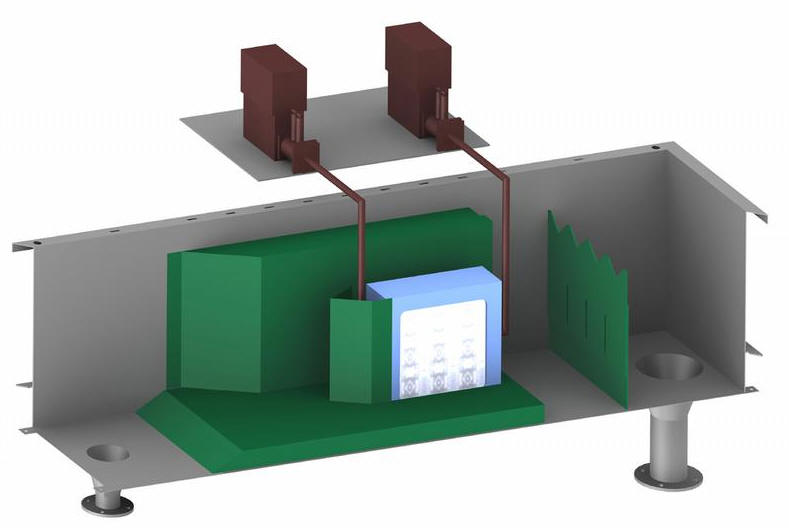
Im Ablaufgerinne einer Kläranlage
fließt Wasser von links nach rechts und wird in der Mitte flächig mit
UV-Licht bestrahlt.
Krankheitsübertragung via Wolken
Globale Gefahr durch Verbreitung von Mikro-Organismen in der Atmosphäre
Ulm (pte/07.04.2005/11:45)
- Mikro-Organismen in den Wolken spielen nicht nur eine kritische Rolle
bei der Verbreitung von Krankheiten, sondern haben auch einen wesentlichen
Einfluss bei der Bildung von Regentropfen. Diese wissenschaftlich radikale
Theorie wird von Andrei P. Sommer von der Universität Ulm http://www.uni-ulm.de
und Chandra Wickramasinghe von der Cardiff University http://www.cf.ac.uk
aufgestellt. Sie kommen durch ihre Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass so
genannte Nanobakterien - Mikro-Organismen, die um ein Vielfaches kleiner
sind als Bakterien - bereits weit verbreitet sind in der terrestrischen
Umwelt und dass es zwingende Beweise gibt, dass sie auch in der
Stratosphäre existieren.
Derzeit wurden Nanobakterien bereits bei Menschen auf vier
verschiedenen Kontinenten nachgewiesen. Die Wissenschafter nehmen an, dass
Nanobakterien eine wesentliche Rolle bei der Ausbreitung und Bildung
gefährlicher Krankheiten - wie beispielsweise Herzkrankheiten, HIV oder
Nierenerkrankungen - spielen. "Experimente haben gezeigt, dass
Nanobakterien vom Körper durch den Urin abgesondert werden und dass ihre
weitere Verbreitung vom Erdboden in die Atmosphäre und Stratosphäre eine
unvermeidliche Konsequenz ist", erklärte Sommer.
Darüber hinaus nehmen die Forscher an, dass durch das Auftreten von
Nanobakterien in den Wolken eine globale Verbreitung von
Krankheitserregern möglich ist. Denn die Mikro-Organismen spielen auch
eine zentrale Rolle bei der Tropfenbildung der Wolken. "Nanobakterien, die
vom Boden durch den Wind in die Wolken gelangen, können zwischen den
einzelnen Aggregatzuständen innerhalb einer Wolke hin- und her pendeln.
Dies führt zu einer Schwingung zwischen den ruhenden und den bewegten
Regionen der Wolke. Dabei agieren Überreste von verunreinigten Proteinen,
die sich auf dem Mikro-Organismus befinden, als extrem effiziente
Wolken-Zellkerne, die eine Wolkenkondensation begünstigen", erläutert
Wickramasinghe.
Die Ergebnisse der Studie wurden in der aktuellen Ausgabe des
amerikanischen Journal of Proteome Research
http://www.pubs.acs.org/journals/jprobs publiziert.
Meere im Innern der Erde?
Innovationsreport 5.4.2005
Gestein (Peridotit) vom mittelatlantischen Rücken mit den
Hauptmineralen Olivin und Pyroxen. Mikroskopische Aufnahme einer 25 mm
dicken Gesteinsscheibe im Durchlicht bei gekreuzten Polarisatoren. Die
Farben (Interferenzfarben) hängen von der Art des Minerals und dessen
Orientierung ab. Die Bildbreite entspricht etwa 0,5 mm. Abbildung:
Institut für Geologie und Mineralogie
Wasser aus Steinen zu holen, ist eine Vorstellung, die etwas
Märchenhaftes an sich hat: vom Zauberstab berührt, öffnet sich der Fels
und gibt das kühle Nass frei. Ganz so wundersam sieht die Welt in den
Augen von Geologen nicht aus; dennoch liefern ihre Entdeckungen Grund
genug zur Verwunderung. Scheinbar „trockene“ Gesteine könnten demnach
große Wasservorräte bergen, und zwar am meisten dort, wo Fachleute bis vor
kurzem am wenigsten vermuteten: in den Tiefen des Erdmantels. Am Institut
für Geologie und Mineralogie untersucht Prof. Dr. Esther Schmädicke die
Wasserspeicherkapazität von Mineralen, die lange als extrem wasserarm
galten.
Bisher ist man davon ausgegangen, daß im Erdmantel unterhalb von 100
bis 150 km Tiefe kein Wasser mehr vorhanden sein dürfte. Diese Annahme
liegt nahe, weil Minerale, die als Wasserspeicher bekannt sind, dem mit
dem Abstand von der Erdoberfläche wachsenden Druck nur begrenzt
standhalten können. Selbst die wasserführenden Minerale mit der größten
Druckstabilität, wie Amphibol und Phlogopit, zerfallen, sobald der Druck
einen Wert von 30 bis 40 Kilobar übersteigt, wie es in der genannten Tiefe
der Fall ist.
Die gewaltige Kraft dieser „Presse“ wandelt Amphibol zum wasserfreien
Pyroxen. Dabei wird Wasser abgegeben, was dazu führen kann, dass Gestein
im Erdmantel schmilzt, also Magma entsteht. Der größte Teil des
Erdmantels, der bis an die Grenze zum Erdkern in 2900 km Tiefe reicht,
sollte demnach nahezu wasserfrei sein, da er nur aus Gesteinen mit
„trockenen“ Mineralen wie Olivin und Pyroxen sowie deren
Hochdruckäquivalenten besteht.
Hoher Druck schafft mehr Defekte
Nach neueren Erkenntnissen ist es allerdings möglich, dass die Gitter
dieser Minerale als Fremdkörper Bausteine von Wasser enthalten, sogenannte
Hydroxyldefekte, Gruppen aus je einem Sauerstoff- und Wasserstoff-Atom.
Der Anteil der OH-Defekte bewegt sich zwischen 10 ppm, zehn Teilchen auf
eine Million, und mehreren 100 ppm. Welche Faktoren den Einbau solcher
Fehlstellen in ein Mineralgitter begünstigen, kann mit Hilfe von
Experimenten geklärt werden.
Für solche „geheimen“ Wasservorräte gilt nicht, dass sie durch
steigenden Druck aus dem Gestein vertrieben werden. Im Gegenteil deuten
erste Ergebnisse der experimentellen Petrologie darauf hin, daß die
OH-Aufnahmekapazität von Mineralen zunimmt, wenn der Druck wächst.
Das würde bedeuten, dass auch tiefere Bereiche des Erdmantels als
Wasserspeicher fungieren können. Die Konzentrationen könnten dort um eine
Größenordnung höher liegen, als sie bisher bei den Versuchen zu messen
waren. Trotz der auch dann noch relativ geringen Anteile von Wasser im
Gestein hätte der Erdmantel aufgrund seines Volumens die Kapazität, eine
Wassermenge zu beherbergen, die die aller Ozeane bei weitem übersteigt.
Die Frage, ob die experimentell ermittelte Speicherkapazität auch den
tatsächlichen Wassergehalten im Erdmantel entspricht, kann heute noch
niemand beantworten. Zu einer Tiefe von mehr als 150 km vorzudringen, ist
nicht möglich; der größte Teil des Erdmantels entzieht sich einer direkten
Untersuchung.
Immerhin können aus vergleichsweise geringen Tiefen Fragmente des
Erdmantels durch Laven an die Erdoberfläche transportiert werden. Darüber
hinaus wurden an den mittelozeanischen Rücken Bereiche entdeckt, in denen
die ozeanische Kruste stellenweise fehlt und die Gesteine des Erdmantels
an der Oberfläche liegen. Analysiert man die Wassergehalte in solchen
Proben, kann zumindest das Wasserreservoir des obersten Erdmantels
abgeschätzt werden. Die Dichte der Hydroxyldefekte in Mantelmineralen
dürfte die physikalischen Eigenschaften des Erdmantels, wie elektrische
Leitfähigkeit oder Fließverhalten, erheblich beeinflussen und auch für
Plattentektonik, Konvektion im Erdinnern, Wärmetransport und Magmatismus
eine große Rolle spielen.
In Erlangen sollen Gesteine vom Mittelatlantischen Rücken (siehe
Abbildung) analysiert werden, die im Rahmen des „Integrated Ocean Drilling
Program“ (IODP) im Bereich 14-16º nördlicher Breite erbohrt wurden. Dieses
Tiefseebohrprogramm, an dem Wissenschaftler aus über 20 Ländern beteiligt
sind, dient der Erforschung von bislang unzugänglichen Bereichen des
Meeresbodens.
Pressemitteilung Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., 05.04.2005 11:08
Neuer Ansatz für rasche, selektive Bestimmung von Blei:
Fluoreszenz-Sonde zeigt Gehalt des Schwermetalls an
Blei ist ein giftiges Schwermetall, das sehr gefährlich für Mensch und
Umwelt werden kann. Bleivergiftungen zählen zu den häufigsten durch
Umweltverschmutzung verursachten Erkrankungen. Für die rasche Diagnostik
und Umweltanalytik vor Ort wäre ein einfacher, handlicher, aber
zuverlässiger Bleinachweis eine wünschenswerte Ergänzung zu den
konventionellen, instrumentell eher aufwändigen Labormethoden. Forscher
von der University of Chicago sowie dem New Yorker Brookhaven National
Laboratory präsentieren nun einen ersten Ansatz für einen solchen
Blei-Schnelltest: Sie haben eine fluoreszierende Sonde entwickelt, die
sehr selektiv auf Blei anspricht.
Nicht alle Lebewesen reagieren negativ auf Schwermetallionen, einige
Organismen, z.B. Bakterien, haben Resistenzen entwickelt. Unter diesen
Bakterien ist Ralstonia metallidurans der einzige bekannte Stamm, der über
einen für Blei spezifischen Resistenzmechanismus verfügt. Dieser wird
immer dann "angeworfen", wenn das Bakterium in eine bleihaltige Umgebung
gelangt. Es muss also in der Lage sein, die Blei-Ionen wahrzunehmen. Dazu
hat es ein "Späher"-Protein, PbrR genannt, das nach Blei-Ionen "Ausschau
hält". PbrR dockt an einer Stelle der Bakterien-DNA an, die als
"Ein-Aus-Schalter" für die Bleiresistenz-Gene fungiert. Gelangen
Blei-Ionen in die Zelle, binden diese an den "Späher", der dabei seine
Form so verändert, dass er die beiden Stränge der DNA ein wenig
auseinander zieht - und damit die Gene "anschaltet".
Dieses System machte sich das Forscherteam um Chuan He zu Nutze. Sie
wählten jedoch nicht PbrR, sondern PbrR691, ein - funktionell zuvor noch
nicht charakterisiertes - eng verwandtes Protein, das sich gentechnisch
leicht in größeren Mengen herstellen lässt. Wie erhofft, erkennt auch
dieser Verwandte Blei-Ionen. Nun galt es noch, die Bakterien-DNA leicht zu
verändern: Innerhalb der "Schalter"-Region ersetzten die Forscher einen
Adenin-Baustein durch ein fluoreszierendes Analogon. Fest eingebunden in
die Doppelhelix der DNA fluoresziert es im bleifreien Normalzustand nicht.
Bindet nun ein Blei-Ion an PbrR691, werden die beiden Stränge lokal
auseinander gezogen. Dadurch ragt der fluoreszierende Baustein aus der
Doppelhelix heraus und beginnt zu leuchten. Anhand der
Fluoreszenz-Intensität lässt sich die Bleikonzentration der Probe
bestimmen. Das Sondensystem reagiert etwa 1000fach empfindlicher auf Blei
als auf andere Metallionen.
"Unsere Bleisonde ist eine Ausgangsbasis für die Entwicklung eines
einfachen, bleispezifischen Analysenverfahrens," sagt He. "Außerdem
erforschen wir, warum PbrR691 so selektiv Blei-Ionen bindet. Die
Erkenntnisse könnten beim Design eines bleibindenden Gegenmittels bei
Bleivergiftungen helfen."
Thema "Wasser" in alle Unterrichtsfächer
integrieren
Güstrower Anzeiger - Dienstag, 5. April 2005
Umweltkolloquium in Güstrow / Angebot an alle Schulen
Güstrow (hjk) • Das nächste Güstrower Umweltkolloquium des Landesamtes
für Umwelt, Natur und Geologie findet am 7. April um 14 Uhr im Hörsaal 26,
Lehrgebäude 1, der Verwaltungsfachhochschule zum Thema "Integration des
Themas Wasser in alle Unterrichtsfächer" statt. Es spricht und diskutiert
Diplom-Biochemikerin Langner vom Umweltbüro Nord Stralsund.
Ausgangspunkt ist die Erfahrung, dass Schulen relativ wenig Freiraum
haben, um wichtige Themen zusätzlich zum vorgegebenen Unterrichtsstoff zu
behandeln. Daher sollen Lehrer angeregt werden, nachhaltigkeitsorientierte
Fallbeispiele zu verwenden, an denen der Unterrichtsstoff praxisnah
behandelt werden kann. Die Projekte können mehrere Fächer einer
Klassenstufe verbinden. Am Beispiel des Themas "Wasser" werden
Anknüpfungspunkte in den schulischen Rahmenplänen aufgezeigt. Für eine
ausgewählte Schulform und Klassenstufe wird skizziert, wie daraus
attraktive und lebensnahe Bildungsprojekte gestaltet werden können.
Schließlich wird modellhaft dargestellt wie Schulen die Entwicklung
derartiger Bildungsprojekte organisieren können.
|
 April
2005
April
2005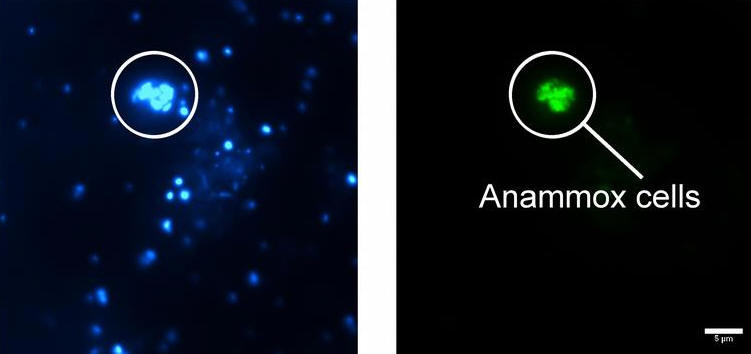
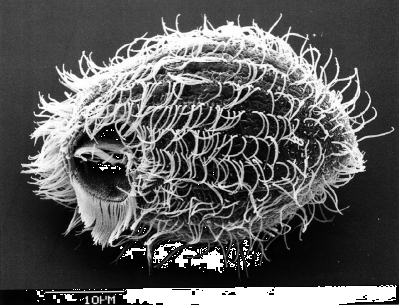 Mit diesem
kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst
eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in
Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im
Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In
den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können
bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.
Mit diesem
kleinen Mund von nur einen Durchmesser von fünf Millionstel Meter frisst
eine Protozoe Bakterien und reinigt damit effektiv die Schlämme in
Kläranlagen. Allerdings nur, wenn die Protozoen nicht von Chemikalien im
Abwasser angegriffen werden, was heute noch nicht getestet werden kann. In
den Belebtschlämmen kommen die Protozoen in vielen Größen vor. Sie können
bis zu acht Mal größer sein als das abgebildete so genannte Tetrahymena.